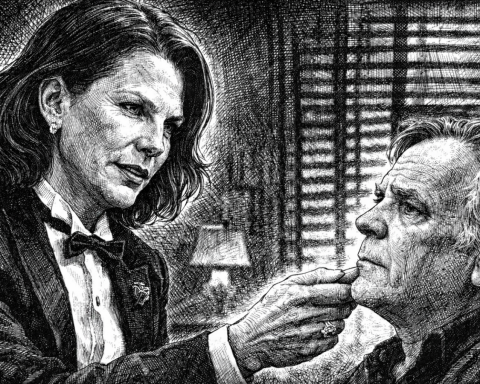Viele Theater wollen den erhobenen Zeigefinger vermeiden. Aber was ist aus der »moralischen Anstalt« von Schiller und Brecht geworden? Gerade heute ist mehr Haltung nötig, um den Lügen der Welt den Garaus zu machen.
English summary: Theater, once hailed as a “moral institution” since Schiller, now shies away from morality, preferring to brand itself as a “school of complexity.” Directors fear alienating audiences in populist strongholds by excluding extremes, but equating lies with opinion creates false balance. Morality, as Hanno Sauer notes, is a shifting social norm system—essential for solidarity and trust. Theater should reclaim its role: not reproducing moods, but defending democratic values, unmasking propaganda, and resisting the normalization of lies. True freedom and moral progress require clear stance, not evasive neutrality.
Woher kommt eigentlich diese neue Angst vor der Moral? Gerade im Theater! Kaum jemand will die Bühne noch als »moralische Anstalt« verstehen. Schillers altes Credo scheint vergiftet. Intendantinnen und Intendanten, Regisseurinnen und Regisseure scheinen die »Moral« zu fürchten wie Alice Weidel das Gendern.
Plötzlich heißt es, dass man »keinen moralischen Zeigefinger erheben« wolle, dass die Bühne eher eine »Schule der Komplexität« sei, ein Ort, an dem alle gesellschaftlichen Positionen aufeinandertreffen müssten. Gerade in Städten mit starken populistischen Parteien steckt dahinter wohl auch der Gedanke, dass man ungern auf einen großen Teil der Gesellschaft verzichten will. Theater haben Angst, Menschen an extreme Parteien zu verlieren, wenn sie die Extreme aus dem Theater ausschließen.
Lügen sind keine Meinung
Aber ist die neue Komplexität der Welt wirklich der Grund für die Spaltung unserer Gesellschaft? Und wären wir wirklich besser beraten, radikale Meinungen (und Lügen) in unseren Alltag zu integrieren? Oder schlimmer noch: Verzichten wir auf unsere eigene Meinung und Moral, weil andere uns lauthals mit erhobenen Zeigefinger unseren eigenen Zeigefinger vorwerfen?
Kurz gefragt: Muss man für jeden und alles Verständnis haben? Reicht der simple Satz »we agree to disagree«, um die Welt wieder ins Lot zu bringen? Ich glaube nicht. Und deshalb, liebe Theater: Wagt endlich wieder mehr Moral! Der Zeigefinger ist nicht allein dazu da, um in der Nase zu bohren.
Das Vermeiden des eigenen moralischen Anspruchs im Theater ist ein vorauseilender Gehorsam vor dem rhetorischen Mythos einer so genannten »woken« Kulturszene. Ein Kampfbegriff, den die Gegner des aufgeklärten Theaters seit einiger Zeit pflegen. Ich halte es lieber mit dem Weimarer Chefregisseur Valentin Schwarz, der sagt: »Als Theater sind wir nicht dafür da, eine herrschende Stimmung zu reproduzieren, sondern wir müssen eine Position einnehmen. Wir müssen sagen: Wir stehen für eine offene, freiheitlich demokratische Ordnung und Grundverfassung.«
Keine Propaganda im Foyer
Theater müssen nicht alle vermeintlichen Wahrheiten gleichberechtigt nebeneinanderstellen. Die Behauptung falscher Fakten oder die Verbreitung von Verschwörungserzählungen hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Und nein, der Satz »Man darf ja gar nichts mehr sagen!« ist (auf jeden Fall in Deutschland) vollkommen daneben! Er wird besonders gern von jenen benutzt, die ihn besonders laut aussprechen.
Wenn etwa das Theater Görlitz der Autorin und Putin-Sympathisantin Gabriele Krone-Schmalz in sein Foyer lädt, wäre es gleichzeitig die moralische Pflicht des Theaters, ihre Aussagen nicht als »Meinung«, sondern als Russland-Propaganda zu entlarven. Auch das ist eine Sache der Moral! Denn wer Extreme ins Haus holt, muss sich nicht wundern, wenn AfD-Mann Tino Chrupalla 48,9 Prozent aller Stimmen holt – so wie in Görlitz bei der letzten Bundestagswahl.
Der Wind hat gedreht
Wir erleben in den USA gerade, wie sich der Wind der Cancel-Culture dreht. Der einstige Kampfbegriff der sogenannten Rechten gegen linke Moral wird zur konkreten Abschaffung der Meinungspluralität durch die Rechte. Mit Jimmy Kimmel oder Stephen Colbert werden Satiriker in den USA von den Sendern genommen, die sich in erster Linie über die unbestreitbaren Lügen und eindeutigen Falschaussagen lustig machen, mit denen Donald Trump und seine MAGA-Bewegung Tag für Tag Stimmung machen.
Colbert und Kimmel sind die Endpunkte amoralischer und diktatorischer Cancel-Culture. Begonnen hat sie schon Monate vorher, mit dem Auswechseln kritischer Geister beim Kennedy Center durch die Nationale Rechte. Und noch früher damit, dass ein großer Teil der einst »moralischen« Kulturschaffenden vor dem Narrativ ihrer Feinde eingebrochen ist. Damit, dass viele Künstlerinnen und Künstler auf das Polemisieren gegen die Moral mit dem freiwilligen Verzicht auf Moral geantwortet haben. Nun ist es zu spät. Erst nachdem Stephen Colberts Late Night Sendung gestrichen wurde, hat er bemerkt, dass man einer Diktatur »keinen Inch entgegenkommen« dürfe, wenn man nicht von ihr verschlungen werden will.
Schöne schiefe Klassik-Welt
Auch in der Klassik gerät längst einiges durcheinander. Es ist eben nicht das Gleiche, ob ein Festival in Flandern Lahav Shani auslädt, weil er kein vorgefertigtes Statement unterschreiben will, oder ob in den Feuilletons debattiert wird, ob es klug ist, wenn der SWR mit öffentlichen Geldern einen Chefdirigenten engagiert, dessen zweites Orchester Gelder von der in Europa sanktionierten VTB-Bank einsteckt. Und natürlich gibt es einen moralischen Unterschied zwischen Künstlern wie Valery Gergiev, die aktiv im Dienste eines diktatorischen Systems stehen (und es propagieren) und Künstlern, die das nicht tun. Ebenso falsch ist es, zu suggerieren, dass, wenn man sich gegen die Ausladung Shanis ausspricht, automatisch das Leid der Menschen in Gaza vergesse. Das ist in den meisten Fällen nichts anderes als eine Lüge!
Es kursiert im Internet ein Video, in dem Charlie Kirk mit einem britischen Professor über Russland und die Ukraine debattiert und – rhetorisch in die Ecke gedrängt – einlenkt, um zu sagen, dass man eben akzeptieren müsse, dass er die Krim für russisch halte und der Professor nicht. Worauf der Professor ihm antwortet, dass dies keine Frage der »Empfindung«, sondern eine Frage des Völkerrechts sei. Mit anderen Worten: Es ist Quatsch zu behaupten, dass es niemals Richtig und Falsch gebe. In Wahrheit ist es die Installation der Lüge als Meinung, die uns an den Punkt gebracht hat, an dem wir heute stehen. Und es wäre die Aufgabe des Theaters, der Inszenierung, den Schauspielern unserer Realität die Masken herunterzureißen – denn die Bühne ist die große Expertin in Sachen Inszenierung.
Es ist nicht alles Meinung, was schreit
Das Theater darf aus Angst vor populistischen Lügen nicht den gleichen Fehler machen, den bereits viele Medien (und das Theater ist ein Medium!) begangen haben. Es mag sein, dass jede Meinung das Recht hat, gleichberechtigt neben anderen Meinungen zu stehen, aber es gerät etwas aus dem Lot, wenn die Lüge gleichberechtigt neben einer Meinung steht. Das nennen wir »false balance«, und genau diese falsche Abwägung nehmen Theater vor, wenn sie den Anspruch aufgeben, Anstalten der Moral zu sein.
Vielleicht liegt das Missverständnis bereits in der Definition der Moral. Moral ist keine feststehende, gültige Regel. Moral hat auch nichts mit einem erhobenen Zeigefinger zu tun. In seinem Buch »Moral. Die Erfindung von Gut und Böse« beschriebt Hanno Sauer, dass Moral ein »sich andauernd verschiebendes Normsystem« sei. Im Laufe der Zeit haben wir Menschen uns darauf geeinigt, dass wir es nicht gut finden, wenn ein Höhlenmensch dem anderen über Nacht sein Mammutsteak klaut, dass der Mittelalter-Mann die Frau seines Nachbarn knutscht oder der Digital Native seine Schulfreundin auf TikTok mobbt. Moral – so schreibt es Sauer – ist »eine Revolution der menschlichen Evolution«. Die andauernde Neubestimmung unserer moralischen Grenzen macht uns erst zu dem, was wir sind. Moral hat unsere Kooperationsfähigkeit, Solidarität und Vertrauensbildung geschaffen. Ohne Moral – so schreibt es Sauer – sind wir lediglich »gewalttätige Egomane«.
Definition der Moral
Das Theater darf sich seine Definition der Moral nicht aus der Hand nehmen lassen. Ebenso wenig sollte sie die Definition der Freiheit den Feinden der Freiheit überlassen. Timothy Snyder ist der aktuell wohl klügste Denker, der uns erklärt, dass Freiheit eben nicht das Wegfallen aller Grenzen bedeutet, so wie es die MAGA-Bewegung uns gern vormacht. Die Absenz von Staat und ökonomischer Regulierung ist das Gegenteil von Freiheit. Denn – so argumentiert Snyder – Freiheit ist keine Frage des egoistischen Individuums, keine Frage des Einzelnen, da es den Einzelnen in der Realität als handelnde Person nicht gibt. Der Einzelne ist immer von anderen umgeben. Freiheit gibt es also nur in der Verhandlung des Kollektivs.
Freiheit und Moral sind Aushandlungsprozesse, und die Bühne ist für diese Verhandlungen der beste Ort. Aber wer verhandeln will, muss Position beziehen.
Um so wichtiger, dass Intendantinnen und Intendanten, Regisseurinnen und Regisseure auf den Bühnen für faire Regeln sorgen. Dass die Lüge nicht zur Schwester der Meinung wird, dass die Erfindung und die Inszenierung Kunstformen bleiben und keine Realpolitik werden.
Haltung – und zwar jetzt!
Grundsätzlich gilt: Es ist keine Schule der Komplexität, der Lüge die Tür zu öffnen und auf die eine eigene Meinung zu verzichten. Und es ist unmoralisch, im Angesicht der Realpolitik die Grundidee des Theaters aufzugeben.
Als Österreich kurze Zeit vor einer rechtsnationalen FPÖ-Regierung stand, habe ich bei Theatermachern nachgefragt, wie sie die Situation einschätzen und als Antwort in erster Linie abwartendes Schweigen geerntet. Dabei ist Haltung erst dann ihren Namen wert, wenn sie auch mit Konsequenzen verbunden ist. Wer aus Angst vor Repressalien seine Moral aufgibt, verrät die Kultur.
Schiller schrieb 1784, dass man die »Schaubühne als eine moralische Anstalt« betrachten solle. Das Theater zwinge uns zur Sammlung und beschenkt uns im Idalfall mit neuem Mut zum Handeln. Die Bühne war für ihn ein Forum für Ästhetik und ein Instrument der Aufklärung. Oder wie Rüdiger Safranski es einmal sagte: Für Schiller stellte das Theater eine »ultimative Lockerungsübung« für die Gesellschaft dar. Und Lockerungsübungen können wir alle gerade gut gebrauchen.
Schiller und Brecht erinnern
Auch Brechts »Episches Theater« wollte die bestehende Moral in Frage stellen: Verfremdung, Kritische Beobachtung und vor allen Dingen offene Enden sollten den Blick auf die Gegenwart verschieben und im besten Sinne »didaktisch« wirken.
Heute haben wir es mit einer weit verbreiteten Diffamierung der Moral zu tun. Warum lassen sich ausgerechnet Bühnenmenschen in diesen Tagen einreden, dass Moral etwas Schlechtes sei? Wahrscheinlich war »moralisches Theater« selten so wichtig wie heute. Und, ja, es ist wichtig, dass die Kunst Haltung bewahrt. Dass sie Ort leidenschaftlicher Debatte bleibt. Das aber geht nur, indem auf der Bühne Behauptungen aufgestellt werden: Ästhetische Behauptungen. Soziale Behauptungen. Emotionale Behauptungen. Politische Behauptungen. Und, klar: Sie müssen Widerspruch zulassen und Gegenbehauptungen ertragen. Aber auch in der Kunst der Inszenierung muss gelten, dass die Lüge eine Erfindung bliebt, um im Idealfall kurzweilig den Horizont des Denkens zu verschieben. Sie darf aber nichts mit der politischen Inszenierung zu tun haben, deren einziger Sinn die Erhaltung der Macht ist.