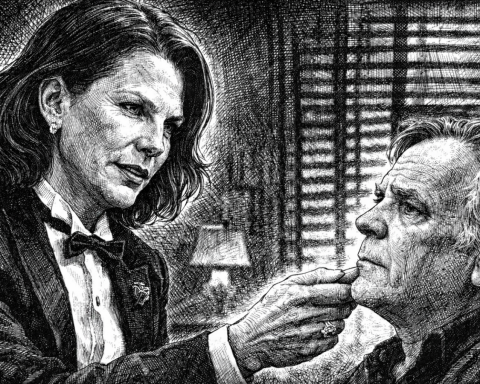Wie die Klassik-Szene ihre politischen und moralischen Leitplanken abbaut: Das Bolschoi kündigt einen Auftritt von Aida Garifullina an, und Auftritte von Teodor Currentzis lösen kaum noch Proteste aus.
English summary: This summer revealed how the classical music scene is dismantling its moral and political boundaries. Despite Russia’s ongoing war in Ukraine criticism fades as cultural institutions return to „normal.“
Das war ein Sommer weitgehend ohne Sommerloch – jedenfalls in der Politik. Im August schien die Welt jeden Tag etwas weiter aus den Fugen gedreht zu sein: Andauernde Eskalation in Nahost, und trotz Alaska-Gipfel und EU-Deligation im Weißen Haus jagt Russland unvermindert Bomben auf zivile Ziele in der Ukraine.
Wenn wir aus den letzten Tagen und Wochen eines gelernt haben, dann, dass Vladimir Putin ein Meister der Inszenierung ist und jedes Bild für Propaganda in eigener Sache nutzt. Nichts scheint ihm wichtiger, als auf die große (westliche) Weltbühne zurückzukehren und so zu tun, als wären sein Krieg gegen die Ukraine und sein diktatorisches Verhalten vollkommen normal. Einige Medien und Menschen helfen ihm dabei, indem sie seiner Politik weitgehend kritiklos begegnen. Und auch ein Großteil der Klassik-Welt scheint in diesem Spiel mitzumachen, ausgerechnet in einer Zeit, in der sich die brutale Machtpolitik Russlands immer deutlicher offenbart. Ein Großteil der Musikszene schließt am liebsten die Augen und tut, als würde sie die Weltpolitik überhaupt nicht betreffen.
Aida Garifullina in Moskau?
So wurde dieser Klassik-Sommer auch ein Sommer der vermeintlichen Normalisierung des alten Geschäfts. Während Italien vor den Sommerferien noch ein von EU-Geldern mitfinanziertes Valery Gergiev-Konzert in letzter Sekunde absagte, kündigte das Bolschoi in Moskau nun eine Gala für den 5. September mit der Sopranistin Aida Garifullina an – angeblich an ihrer Seite: Vadim Repin, Svetlana Zakharova, Evgeny Mironov, Irina Shishkova und der Dirigent Anton Grishanin.
Teodor Currentzis zog derweil mit seinem Utopia-Ensemble durch die Gegend und wurde dabei von der Kritik zum großen Teil gefeiert (in Salzburg etwa gemeinsam mit der Sopranistin Regula Mühlemann). Die politische Auseinandersetzung um den Dirigenten und die Finanzierung seiner Ensembles tritt dabei wieder in den Hintergrund.
Kritik ist selten
Bei einem Event wie dem Musikfest Bremen stimmen regionale Platzhirsch-Medien wie der Weser-Kurier in den weitgehend kritiklosen Jubel ein. Immerhin hat die vermeintlich noch regionalere Kreiszeitung bei den Veranstaltern nachgefragt und bei der verantwortlichen Kulturpolitikerin, die Steuergelder für das Unterfangen ausgibt. Die Antworten klangen allerdings weitgehend abgeklärt: Intendant Thomas Albert schwadroniert irgendetwas darüber, dass Musik nun mal Musik sei und Politik Politik – und überhaupt in der Causa Currentzis alles gesagt wäre. Und während die Bundesregierung händeringend nach Auswegen gegen Russlands perversen Angriffskrieg und die Bombardements der Zivilbevölkerung sucht, scheinen die regionalen Kulturpolitiker der Regierungsparteien so zu tun, als habe ihre Arbeit nichts mit der Weltpolitik zu tun. Sie habe Urlaub, erklärte Bremens Kulturdezernentin Carmen Emigholz und könne sich deshalb nicht zur Causa äußern, und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte, der auch Kultursenator ist und ansonsten immer gern große Politik spielt (etwa bei seinen Markus Lanz-Auftritten), blieb in diesem Fall ebenfalls stumm.
London ringt um Netrebko
Da mutet es fast absurd an, dass ausgerechnet Anna Netrebko, die sich nach anfänglicher Kritik immerhin streng daran gehalten hat, nicht mehr in Russland aufzutreten, nun ausgerechnet den größten Shitstorm abbekommt. Gegen ihren geplanten Auftritt am 7. September 2025 in Covent Garden haben mehr als 50 Kulturschaffende in einem Brief im Guardian protestiert, unter ihnen die ukrainischen Schriftsteller Andriy Kurkov and Serhiy Zhadan, der Oscar-Preisträger Mstyslav Chernov die ehemalige Premierministerin Neuseelands, Helen Clark oder der französische Intellektuelle Bernard-Henri Lévy. Auf Facebook kursiert ein Bild das ein vermeintliches Plakat der Royal Opera zeigt, in der sie mit Uralt-Zitaten Putin bewundert. Es ist davon auszugehen, dass die London-Proteste gegen Netrebko heftiger ausfallen werden als einst die Demonstrationen in Wien oder Berlin.

Ebenso wie gegen Netrebkos Auftritt wurden auch gegen das erste Konzert von François-Xavier Roth beim SWR Symphonieorchester Proteste angekündigt. Die Orchester-PR setzt derweil auf eine ähnliche Masche wie schon in der Currentzis-Debatte: Abducken und Thema wechseln. Dafür ist in diesem Fall (die ebenfalls vom SWR beschäftigte) Journalistin Susanne Benda verantwortlich, die in der Stuttgarter Zeitung ein Roth Interview veröffentlichte, in dem sie den Dirigenten weitgehend unkommentiert erklären ließ: »Mir ist jetzt sehr bewusst, was ein Dirigent als Führungspersönlichkeit tun muss und tun darf. Ich denke, ich bin heute ein anderer Mensch und ein anderer Dirigent. Ich verstehe, dass viele damals sehr irritiert waren, aber ich habe mir Zeit genommen und komme zurück mit großer Energie für unser Orchester, für die Musik.«
Mit anderen Worten: War was? Ist was? Wollen wir nach diesem Sommer wirklich so weiter machen wie immer? Oder wäre es nicht gerade jetzt an der Zeit, auch in der Kultur ein politisches Bewusstsein zu etablieren?
Leseempfehlung: In einem Essay zum Jahresbeginn haben wir erklärt, warum es gerade jetzt wichtig ist, Kunst und Kultur als politische Kraft zu verstehen.