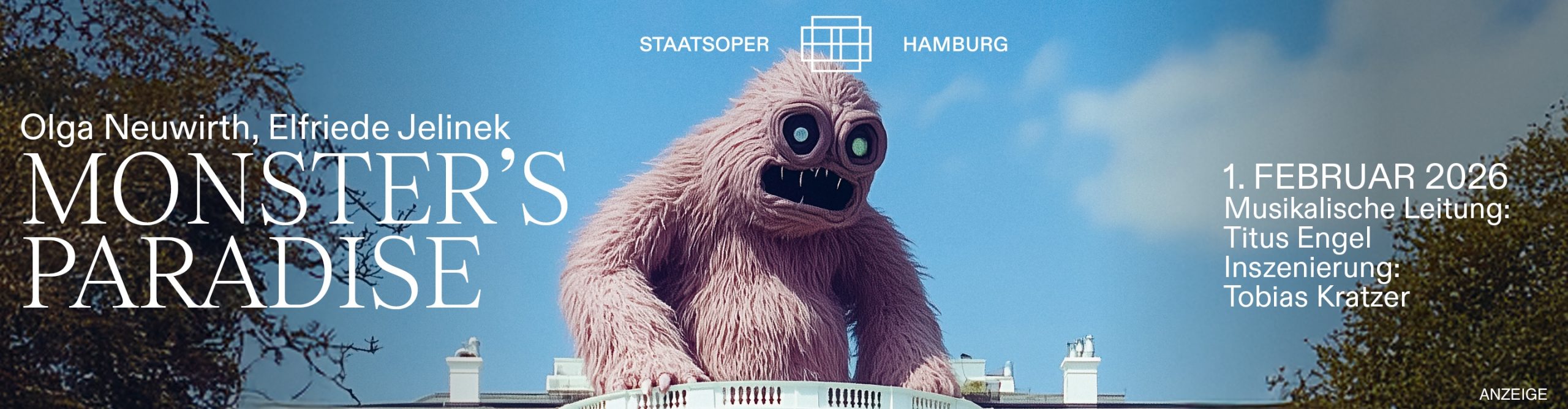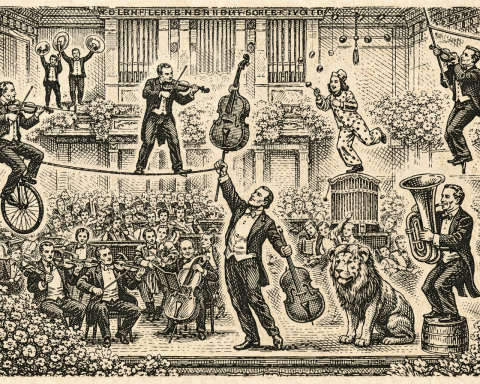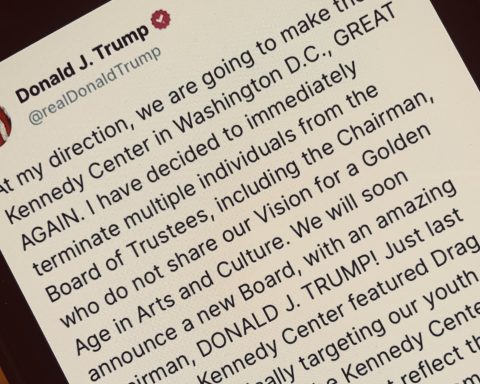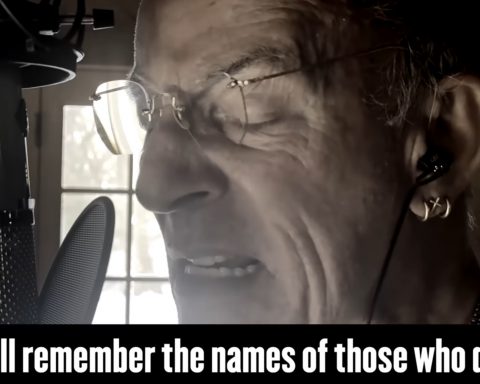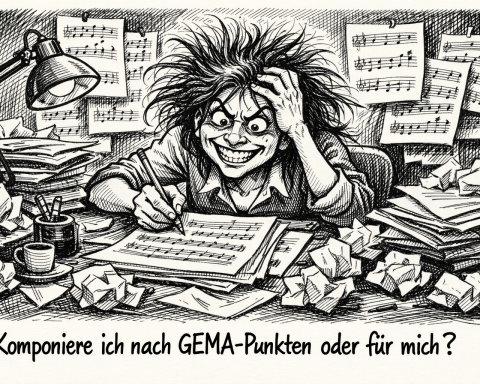Die Wiener Philharmoniker sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Sind die musikalischen Probleme nur die Oberfläche eines veralteten Orchester-Systems? Eine Analyse.
English summary: The Vienna Philharmonic is facing harsh criticism for declining musical quality and outdated structures. Leadership appears defensive, lacking modern management expertise. The orchestra clings to tradition, losing relevance in a changing classical world. Without structural reform, it risks becoming a glamorous but hollow symbol of past greatness.
Anfang der Sommerferien hat der Musikredakteur der FAZ, Jan Brachmann, eine ziemlich gepfefferte Abrechnung mit der musikalischen Qualität der Wiener Philharmoniker veröffentlicht. In Sachen Beethoven würde das Orchester längst hinter Paavo Järvis Kammerphilharmonie Bremen rangieren, in Sachen Mozart seien die Wiener unter anderem vom Ensemble il Pomo d‘Oro überholt worden und bei Gustav Mahler vom Mahler Academy Orchestra. Bei Richard Strauss sei Franz Welser-Mösts Elektra vor vielen Jahren bei den Salzburger Festspielen der letzte Höhepunkt gewesen. Hat Brachmann eine Agenda? Auf jeden Fall hat bislang wohl niemand schonungsloser über die musikalische Entwicklung des Traditionsorchesters geschrieben.
Hinter den Kulissen hat der Artikel das Sommerloch mit allerhand Erregung gefüllt. Öffentlich schien das Orchester die Kritik weitgehend zu ignorieren. Statt auf Verteidigung setzten die beiden Vorstände, Daniel Froschauer und Michael Bladerer, bei einer Pressekonferenz in Salzburg auf Angriff. Besonders Froschauer redete sich da gegen Österreichs Kulturpolitik in Rage: »Sie ist nicht optimal aufgestellt«, erklärte er, »wir brauchen Kulturpolitik von Leuten, die dort zu Hause sind.« Genau das sei aber nicht der Fall. Froschauer weiter: »Ich kann auch nicht Direktor eines Spitals werden – aber in der Politik geht das.«
Es stellt sich die Frage nach Kompetenz
Es verwundert, dass ausgerechnet Froschauer der österreichischen Politik Inkompetenz vorwirft und kritisiert, dass in der Regierung zu viele Menschen säßen, die eigentlich für etwas anderes ausgebildet seien. Froschauer ist von Haus aus Geiger, Geschäftsführer Michael Bladerer ist Kontrabassist. Da stellt sich durchaus die Frage, was die beiden eigentlich qualifiziert, ein weltweit operierendes Orchester zu managen, einen sich selbst verwaltenden Apparat mit komplexen Medien-Verträgen, globalem Tourneegeschäft und modernem Marketing. Ein Millionen-Geschäft, das bei anderen Ensembles oft von einem mit allen Wassern gewaschenen Kulturmanager koordiniert wird.
Nach den Sommerferien legte Jan Brachmann in der FAZ nun noch einmal nach, als er den Wiener Philharmonikern im Vergleich mit den Berlinern vorwarf: »Weltrang hält man nicht, wenn man sich ausruht, weil man glaubt zu wissen, wie die Musik geht.« In beiden Verrissen hat er lediglich über den Verlust der musikalischen Qualität des Orchesters geschrieben – seine strukturelle Krise hat er dabei gar nicht thematisiert. Auffällig ist allerdings, dass die Wiener Philharmoniker in den letzten Jahren zusehends ihren Markenkern verengt haben. Heute fallen einem wohl als erstes die Klischees des Orchesters ein: Das Neujahrskonzert und das Open-Air Konzert in Schönbrunn. Dann vielleicht noch die Verbundenheit mit alten – zum Teil sehr alten – Dirigenten wie Zubin Mehta oder Riccardo Muti. Außerdem eine musikalische Ungenauigkeit, die einst als »Musikantentum« (man kann dieses Wort nicht mehr hören!) gefeiert wurde.
Konservativ oder reaktionär?
Selbst der Markenkern des Konservativen droht umzuschlagen in ein eher reaktionäres Image. Die Wiener Philharmoniker stehen weitgehend nackt da, wenn es um Frauen am Pult geht. Anderenorts (etwa an der Staatskapelle in Berlin oder in Cleveland) ist man längst sicher, dass jemand wie Elim Chan (Frau hin oder her) derzeit eine der spannendsten Pult-Persönlichkeiten ist. Und auch die Berliner Philharmoniker werden seit vielen Jahren regelmäßig von Frauen dirigiert, unter ihnen Namen wie Susanna Mälkki oder Emmanuelle Haïm.
Die Verteidigungsstrategie des Orchesters entschärft die Kritik kaum: Man müsste lange mit Dirigenten zusammengearbeitet haben, bis sie auch zum Neujahrskonzert eingeladen würden, erklärten die beiden, just bevor sie bekannt gaben, dass Yannick Nézet-Séguin das kommende Jahr im Musikverein einläuten wird – ein Dirigent, mit dem das Orchester vorher nun wirklich eher sehr selten zusammengespielt hat.
Eher amüsant war da ein Instagram-Video, in dem die Vorstände des Orchesters neben Andris Nelsons saßen und mit ihm ein weitgehend belangloses Interview über russische Musik auf »Denglisch« führten. All das passt nicht mehr zum einst stilsicheren Gold-Image, in dem die Wiener Philharmoniker sich sonst so gern sonnen und für das Sponsoren wie Rolex eigentlich einmal gekommen waren.
Kein Kompass mehr
Vor allen Dingen scheint das Orchester seit einiger Zeit aber den Kompass in der aktuellen Klassik-Szene verloren zu haben. Während die Wiener Philharmoniker das gefühlt 100. Thielemann-Konzert mit Brahms, Bruckner oder Beethoven präsentieren, haben ausgerechnet die Wiener Symphoniker mit dem Engagement von Petr Popelka Mut bewiesen. Ihr Chefdirigent kommt bald zu den Berliner Philharmonikern, in Cleveland war er bereits erfolgreich.
Früher war das genau andersherum: Die Philharmoniker hatten das bessere Näschen für den Nachwuchs. Der eigentliche Erfolg des Orchesters lag darin, dass es Dirigenten wie Claudio Abbado, Zubin Mehta oder Franz Welser-Möst als junge Musiker entdeckt und dann kontinuierlich gefördert hat. Heute ist die Verpflichtungspolitik dagegen eher wankelmütig. Ausgerechnet die Philharmoniker verlassen ihr Credo der Stabilität und Kontinuität und schielen stattdessen auf den immer schneller drehenden Klassik-Mode-Markt. Da wird ein Stückchen mit einem gehypeten Dirigenten wie Lorenzo Viotti gegangen, dann wieder Klaus Mäkelä engagiert, der seine eigentliche Heimat längst in Amsterdam und Chicago gefunden hat. Zu Hause ist von den jungen Musikern kaum noch jemand in Wien.
Hinzu kommt, dass die Bedeutung des Opernorchesters bei den Wiener Philharmonikern aus dem Fokus gerückt zu sein scheint. Zum Einen, weil an der Wiener Staatsoper niemand mehr auf die Qualität im Orchestergraben zu achten scheint, zum Anderen, weil der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, schon fast gegen das eigentliche Festival-Orchester programmiert und die großen Auftakt-Premieren gern andere, kleineren Spezialisten-Ensembles überträgt (diesen Sommer etwa Emmanuelle Haïms Ensemble Le Concert d‘Astrée).
Und auch Brachmann erklärt in seinem FAZ-Verriss, dass die Wiener Philharmoniker unter dem gleichen Dirigenten (Esa-Pekka Salonen) im Salzburger Fernduell den Kürzeren gegen das Finnische Rundfunk-Sinfonieorchester gezogen hätten.
Überbordende Selbstwahrnehmung
Kurzum: Die überaus selbstbewusste Selbstwahrnehmung der Wiener Philharmoniker scheint sich schon länger nicht mehr mit der (internationalen) Außenwahrnehmung des Orchesters zu decken. Klar, für einen Großteil der österreichischen Medien ist das Orchester sakrosankt. Aber gerade diese heimischen Beißhemmungen könnten auch ein Grund dafür sein, dass die Wiener immer provinzieller agieren. Zu Hause ist das Orchester unangefochtener Platzhirsch, aber auswärts bröckelt der Ruhm.
Es mag sein, dass das Orchester sich selber als Lordsiegelbewahrer der Musik versteht, als konservatives Ensemble, das nichts von modernem Wandel hält. Als eine Art katholische Kurie der Klassik. Was dabei aus dem Blick gerät: Die Klassik-Welt befindet sich längst in einem massiven Wandlungsprozess. Sie ist kein Mainstream-Medium mehr, das durch hochpolierte Goldglanz-Langeweile Aufmerksamkeit generiert. Früher hieß es oft: »Die Berliner Philharmoniker sind das beste Orchester der Welt, die Wiener Philharmoniker das Schönste.« Aber die Schönheit ist angekratzt und vergilbt.
Das Grundproblem des Orchesters scheint seine Struktur zu sein. Im modernen Klassik-Markt geht es darum, internationale Tourneen zu organisieren, Neues zu entdecken, den Markenkern an die Zeit anzupassen und vor allen Dingen darum, das eigene Qualitätsbewusstsein immer wieder neu zu definieren. Junge Musikerinnen und Musiker beklagen hinter vorgehaltener Hand ebenfalls die stagnierende musikalische Entwicklung des Ensembles.
Bekannte Fehler
All das erinnert in vielen Zügen an die Krise der Berliner Philharmoniker am Ende der Ära von Simon Rattle. Man hatte den eigenen Klang verloren und war beliebig geworden, das Repertoire stagnierte, und von der einstigen Aufbruchstimmung war nur noch wenig übrig. Die Berliner Philharmoniker reagierten ebenso spät wie mutig: Statt für den Favoriten Christian Thielemann entschieden sie sich für den Underdog, der allein dem kompromisslosen Musizieren verpflichtet ist. Kirill Petrenko fordert die Musikerinnen und Musiker seither, setzt die musikalische Priorität wieder ganz nach oben und hat in vielen mühsamen Jahren einen Klangkörper geschaffen, der motiviert, musikalisch fundiert und damit wieder unangefochtene Weltspitze ist!
Zudem können sich die Musikerinnen und Musiker in Berlin ganz auf die Musik konzentrieren, während eine erfahrene Managerin wie Andrea Zietzschmann sich um das Geschäft kümmert.
Wenn die Wiener Philharmoniker die aktuelle Kritik an ihrer Arbeit ernst nehmen, wird ein kurzes Innehalten kaum reichen. Die Kritik an der schwindenden, musikalischen Qualität ist in Wahrheit nur ein Problem an der Oberfläche. Die wahre Krise sitzt tiefer, in der Struktur des Orchesters, in seinem Selbstbild und in seiner aktuellen Personalpolitik. Die Wiener Philharmoniker sollten überlegen, ob es nicht an der Zeit ist, das Orchester vollkommen neu zu denken. Derzeit ist man auf dem Weg zu einem goldlackierten Tourismus-Tanker, der mit Sicherheit noch einige Jahre allerhand Dukaten abwirft. Aber was kommt dann? Um wirklich wieder an die Weltspitze zu kommen, reicht ein neuer Anstrich nicht aus – dafür wäre viel Arbeit nötig.