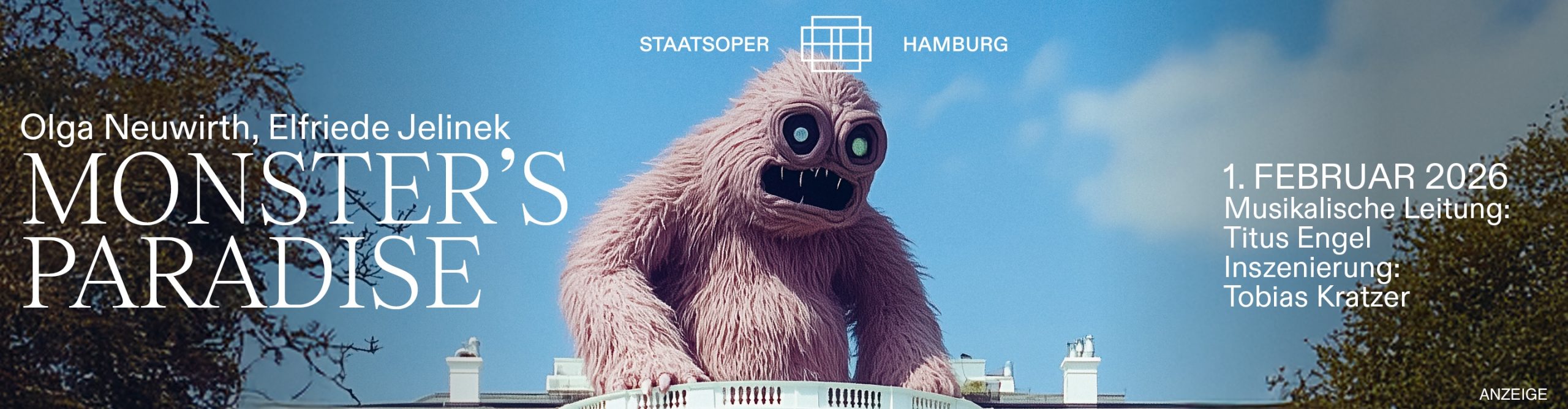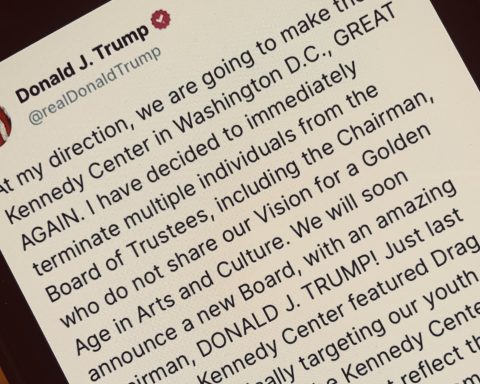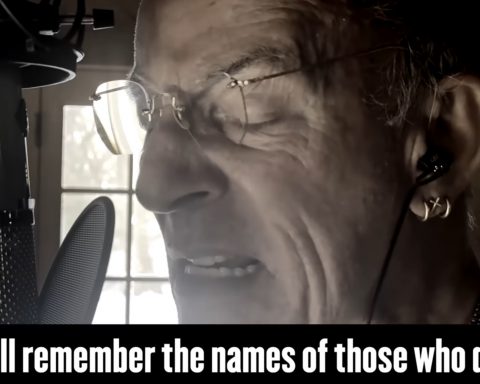Eine Zwischenbilanz der Ruhrtriennale: Innovation, Ambition – aber auch ein bisschen Langeweile. Eine Einordnung von Guido Krawinkel.
English summary: The Ruhrtriennale offers innovation and ambition with mixed results. Highlights include Venables’ daring opera We Are the Lucky Ones, immersive sound experiments, and industrial venues turned into art spaces. Yet, some projects felt tedious or overly conceptual, lacking real impact.
Musiktheater ist lebensgefährlich! Opernsänger und Bühnenarbeiter riskieren tagtäglich ihr Leben, turnen am Rande von tiefen Bühnengräben herum, klettern auf rauf- wie runterfahrenden Bühnenelementen oder agieren auf einer Spielfläche während über ihren Köpfen tonnenschwere Kulissen schweben. Ganz so spektakulär war es jetzt nicht, was man bei der deutschen Erstaufführung von Philip Venables als Oper betiteltem Opus We are the Lucky Ones in der Bochumer Jahrhunderthalle erleben konnte. Es hätte aber vermutlich jedem Sicherheitsbeauftragten die Schweißperlen auf die Stirn getrieben.
Gegenstände auf dem Laufsteg bewegen
Die Spielfläche: Ein großes Karree, das man in die Jahrhunderthalle hineingebaut hatte. In der Mitte ein riesiges Loch. Dort, im akustischen Orkus, hatte man eine Etage tiefer das Orchester platziert, während die Protagonisten – insgesamt acht an der Zahl – auf dem Laufstegkarree vor Publikum agierten. Es kam wie es kommen musste: einer der Darsteller hatte sich bei den Proben verletzt, so dass die choreografischen Elemente der Produktion angepasst werden mussten. Das fiel am Premierenabend allerdings nicht sonderlich auf, denn im Grunde genommen besteht der von Ted Huffman konzipierte Abend nur darin, dass Solisten in wechselnden Konstellationen Texte von Personen aufsagen oder singen, die in der Nachkriegszeit geboren wurden, dabei ein paar Requisiten bewegen und auf dem Laufsteg hin und her spazieren.
Als Oper im engeren Sinne kann man das eigentlich nicht bezeichnen, eher als musiktheatralische Aktion, szenische Collage oder was auch immer. Natürlich folgt die Collage neben dem chronologischen Roten Faden auch einem dramaturgischen Rhythmus. Die Texte, die von banalen Beobachtungen und persönlichen Erinnerungen bis hin zu scharfsinnigen Sentenzen reichen, bieten teilweise aufschlussreiche Einsichten, gerade auch vor dem aktuellen politischen Hintergrund. Aber wäre nicht Philip Venables polyglotter Soundtrack, der von den Bochumer Symphonikern ganz formidabel gespielt wird, wäre der Abend ziemlich öde. Bassem Akiki dirigiert mit stupender Präzision und Ruhe, die Solisten der von der Dutch National Opera übernommenen Produktion sind durchweg erstklassig.
Das Prinzip Ruhrtriennale
Die Produktion in der Jahrhunderthalle ist in gewisser Weise typisch für das Konzept der Ruhrtriennale: man bewegt sich zwischen Zeche und Zeitgeist. Die Atmosphäre der historischen Industrieanlagen und moderne Theater-, Tanz-, Musik- und Opernproduktionen gehen Hand in Hand – eine Symbiose zwischen Alt und Neu. Für die Ruhrtriennale werden Spielorte wie die Jahrhunderthalle in Bochum, die Zeche Zollern in Dortmund, die Halde Haniel in Bottrop oder die Zechen Zollverein und Carl in Essen von stillgelegten Industrieanlagen zu Tempeln für zeitgenössische Kunst. Fast 50.000 Besucherinnen und Besucher lockt die Ruhrtriennale Jahr für Jahr mit Musik, Theater, Literatur und Tanz an. Das Besondere: Alle drei Jahre übernimmt ein neuer Intendant die künstlerische Leitung und gibt dem Festival eine eigene Handschrift.
Die Idee zur Ruhrtriennale entstand 1999. Man suchte nach einer Möglichkeit, die stillgelegten Zechen und Kraftwerke der Internationalen Bauausstellung Emscher Park mit neuem Leben zu füllen. 2002 fiel unter Gerard Mortier der Startschuss, 2005 sorgte Jürgen Flimm mit einer Neuinszenierung von Die Soldaten in der Jahrhunderthalle Bochum für Schlagzeilen. Danach folgten Intendanten wie Willy Decker, Heiner Goebbels und ab 2015 der Niederländer Johan Simons. Derzeit hat der belgische Regisseur Ivo Van Hove die künstlerische Leitung inne, 2026 übernimmt Lydia Steier.
Flop mit Eidinger
Die Industriekulisse des Ruhrgebiets und die Kultur gehen dabei zuweilen sinnige Symbiosen ein, manches freilich scheint auch dem Zeitgeist geschuldet. Die diesjährige Eröffnungsrevue etwa. Hinter dem Titel I Did It My Way verbarg sich ein musikalisches Projekt mit Songs von Frank Sinatra und Nina Simone. Lars Eidinger und Larissa Sirah Herden tanzten und sangen. Der Abend fiel bei der Presse größtenteils durch.

Manchmal gibt es aber auch spannende Querverbindungen, etwa wenn das Will Gregory Moog Ensemble in der Turbinenhalle der Jahrhunderthalle mit einer Hommage an Wendy Carlos analogen Synthesizersounds huldigt: elektronische Musik handmade, ganz old fashioned. Analoge Zeitgenossen mögen dabei an die Titelmusik der Wissenschaftssendung Abenteuer Forschung im ZDF gedacht haben, in der diese Dinosaurier der elektronischen Instrumente zur Anwendung kamen. Ein zweifelsohne nostalgischer aber auch ergiebiger Abend. Mehr Geduld war in der Evangelischen Kirche am Katernberg in Essen gefragt.
10 Minuten hätten gereicht
124 Years of Reverb von Jonny Greenwood stand hier auf dem Programm, das allerdings nicht 124 Jahre, sondern »nur« acht Stunden dauerte. Dafür hatte man mit Eliza McCarthy und James McVinnie gleich zwei Organisten angeheuert, die sich bei Greenwoods Geduldsübung abwechselten. Zuhörer konnten sich für Zwei Stunden-Slots oder die komplette Länge entscheiden, wobei rein strukturell gesehen auch 10 Minuten gereicht hätten.
Dann hatte man das musikalische Procedere schon durchschaut – der Rest war Meditation. Spannend war es aber durchaus, wie der immergleiche und nur leicht variierte Ablauf eines musikalischen Patterns die Wahrnehmung veränderte. So ein Projekt lässt sich im normalen Konzertalltag kaum realisieren, die zwischen Zeitgeist und Zechenkultur pendelnde Ruhrtriennale indes, die ihre Antennen immer wieder in verschiedenste Richtungen der Sub- und Hochkultur ausstreckt, ist ein idealer Ort für solche Experimente.