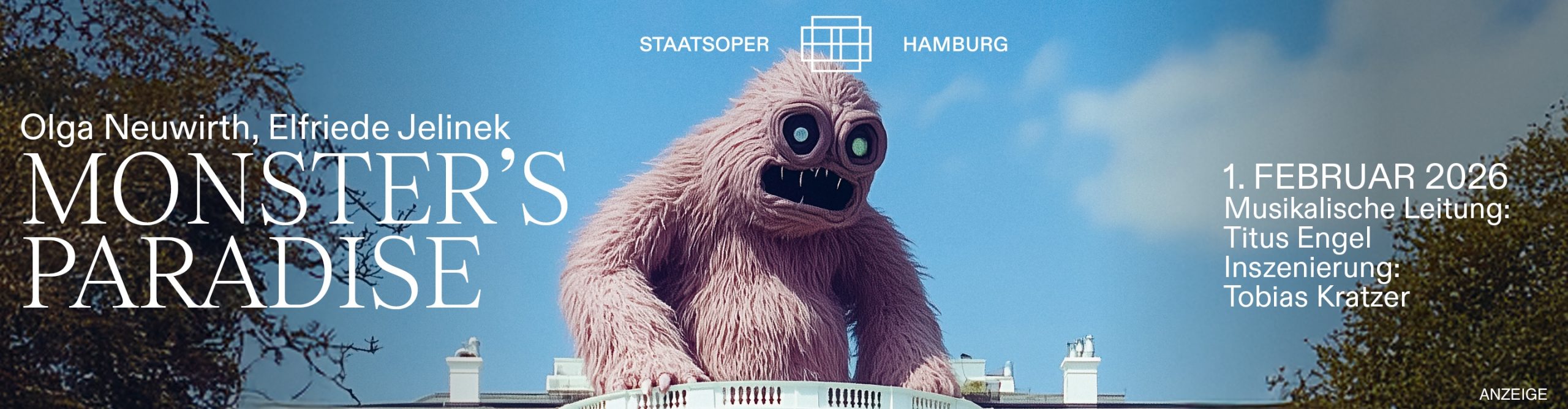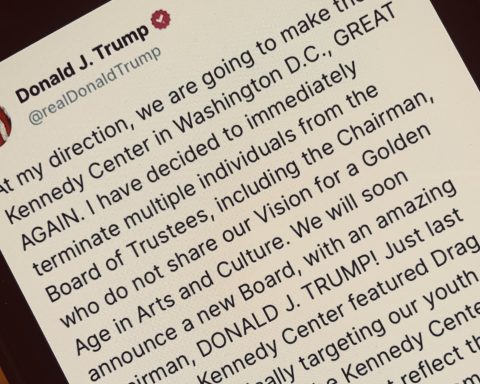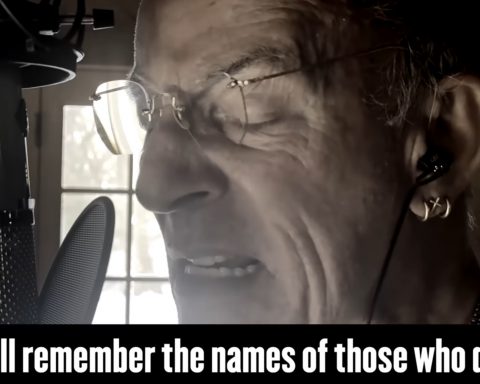Die Wiener Philharmoniker stehen in der Kritik. Nun verteidigt der Vorstand seinen Kurs und erklärt, seine Kritiker wollen sich nur wichtigmachen. Na, dann ist ja alles gut.
English summary: Vienna’s New Year Concert shines as ever, but backstage the Vienna Philharmonic faces criticism for slipping quality, arrogant leadership, weak strategy, fading influence, and resistance to change.
In Wien wird zu Neujahr alles sein wie immer: Die Türen zum Goldenen Saal des Musikvereins werden sich knarzend öffnen, das Orchester wird Platz nehmen, Dirigent Yannick Nézet-Séguin wird auftreten – und nach allerhand Walzer wird es heißen: »Prosit Neujahr!« Und dann: Radetzky-Marsch!
Derweil geht es hinter den Kulissen der Wiener Philharmoniker etwas aufregender zu. Das Orchester steht seit einiger Zeit in der Kritik. FAZ-Mann Jan Brachmann hatte als erster Bedenken über die mangelnde musikalische Qualität der Wiener Philharmoniker angemeldet (»Weltrang hält man nicht, wenn man sich ausruht, weil man glaubt zu wissen, wie die Musik geht.«). BackstageClassical hat unter der Überschrift Altes Gold nach den Strukturen hinter dem Klang geschaut, und Wolfram Goertz subsumierte später in der Rheinischen Post: »So darf man wohl sagen, dass die Arroganz der Wiener Philharmoniker nicht jederzeit durch Qualität legitimiert scheint.« Inzwischen schmunzelt auch der britische Kritiker Norman Lebrecht über den Aktionismus der Philharmoniker, und erst kürzlich – nach der Fidelio-Premiere an der Wiener Staatsoper – wunderte sich Markus Thiel vom Münchner Merkur über die »Schlampigkeit« des Orchesters, in dem an diesem Abend viele erste Pulte mit Wiener Philharmonikern besetzt waren.
Das Problem der Vorstände
Im Zentrum der Kritik stehen die beiden Vorstände, der Geiger Daniel Froschauer und der Kontrabassist Michael Bladerer. Für ihren aktuellen Befreiungsschlag haben sie sich nicht die FAZ oder die Süddeutsche ausgesucht, sondern das österreichische Magazin News. Und dem diktiert Daniel Froschauer über seine Kritiker nun folgendes in die Feder: »Ich vermute, dass sich Leute wichtig machen wollen, um ihr Selbstwertgefühl zu steigern.« Zack-zack. Problem gelöst!
Nicht ganz. Froschauer und Bladerer finden, dass im Grunde alles ziemlich rund laufe, dabei zeigt ihr vollkommen unreflektiertes Interview nicht nur die Enge ihres eigenen Denkens, sondern auch das grundsätzliche Problem ihres Orchesters: Wandel wird durch ein offenbar sehr groß geratenes Selbstbewusstsein verdrängt.

Während Froschauer und Bladerer sich um Kopf und Kragen reden, werden die Schwächen ihres Managements immer offensichtlicher. Jenseits der bekannten Kritikpunkte (immer gleiche Dirigenten, zu wenig Frauen, zu enges Repertoire, es dreht sich zu viel ums Geldverdienen und zu wenig um die musikalische Entwicklung) sind nun auch strategische Fehler erkennbar, die früher so kaum passiert wären. Die Philharmoniker lassen sich inzwischen sowohl kulturell als auch politisch unterbuttern.
Zweite Geige in Salzburg
So wird die erste große Opernpremiere der Salzburger Festspiele nicht von den Wiener Philharmonikern gespielt, sondern vom Utopia Orchester unter Teodor Currentzis. Der Dirigent und Hinterhäuser-Freund hatte den Philharmonikern bereits mit Mozarts Don Giovanni die Show gestohlen und wird das 2026 erneut schaffen – mit Georges Bizets Oper Carmen (Asmik Grigorian in der Titelrolle sorgt für weitere Aufmerksamkeit). So etwas wäre früher undenkbar gewesen, der Vorstand hätte protestiert, sich den Intendanten zur Brust genommen, um klar zu machen, auf wessen Schultern die musikalische Seite der Festspiele ruht. Und heute? Froschauer sagt im News-Interview, Hinterhäuser sei »ein sehr, sehr guter Partner für uns. Wir würden uns nie gegen ihn wenden.« Man kann sich vorstellen, wer bei den Programmdiskussionen Koch und wer Kellner ist.
Auch die weitere Programmierung des Philharmoniker-Programms bei den Salzburger Festspielen ist eher enttäuschend: Thielemann und Muti, das ist so altbacken wie inzwischen viele der Abende im Abonnenten-Programm des Musikvereins. Und dann kommt (Hilfe, eine Frau muss her!) ausgerechnet Joanna Mallwitz zurück, um noch einmal Mozart zu dirigieren. Puh!
Und dann noch das: Berliner Philharmoniker, die den Wienern spieltechnisch seit Jahren überlegen sind, rücken der Konkurrenz zunehmend auch im eigenen Gäu auf die Pelle: Ihr Europakonzert feiern sie 2026 bei den Esterhazys in Eisenstadt, und noch gefährlicher wird die Rückkehr des Orchesters von Kirill Petrenko nach Salzburg, wo die Berliner in den kommenden Jahren bei den Osterfestspielen Wagners Ring aufführen werden.
Zudem schaffen die Wiener Philharmoniker es nicht einmal mehr, in ihrem eigenen Wohnzimmer, der Wiener Staatsoper, das Opernorchester zum Glänzen zu bringen. An vielen Abenden herrscht hier einfach Routine nach Vorschrift, selbst bei Premieren wie neulich von Fidelio hört Kritiker Markus Thiel eine Stimmung »wie in einer Repertoireaufführung«. Ist der alte Glanz nur noch bröckelnde Selbstgefälligkeit?
Kürzungen der staatlichen Mittel
Das Orchester bekommt inzwischen auch kulturpolitisch die Konsequenzen seiner eigenen Trägheit zu spüren. In den Sparrunden des Wiener Kulturhaushaltes fällt ausgerechnet die Unterstützung für das Schönbrunn-Konzert der Wiener Philharmoniker weg. Ein unmissverständliches Zeichen, dass die Bedeutung eines »goldenen Orchesters« in schwierigen Zeiten innerhalb einer Stadtgesellschaft nicht mehr all zu groß ist. Die Wiener Philharmoniker sind nicht mehr so unantastbar, wie sie es nach eigener Wahrnehmung sein sollten. Ihre öffentliche Wirkung entspricht nicht mehr der eigenen. Oder anders ausgedrückt: Unzeitgemäßer als Froschauer und Bladerer kann man heute kaum durch die Gegend gehen. Sie vertreten einfach nicht mehr das moderne Wien, und wohl auch nicht die Klassik des 21. Jahrhunderts.
Die Wiederwahl der Vorstände ist alles andere als sicher. Innerhalb des Orchesters soll es inzwischen Leute geben, die sich dafür aussprechen, dass das selbstverwaltete Orchester eine Art Intendanten bestellt, um die Wiener Philharmoniker strategisch neu aufzustellen. Das wäre ein deutlicher Angriff auf den derzeitigen Vorstand.
Bergauf ist anstrengend
Aber dieser Weg würde auch nur dann eine Chance haben, wenn sich innerhalb des Orchesters die breite Erkenntnis durchsetzt, dass man derzeit auf dem besten Weg ist, ein Touristen-Orchester mit der Trademark »Neujahrskonzert« zu werden. Wenn das Ensemble die Dringlichkeit von Innovation auch mitträgt. Wenn allen klar ist, dass eine Orientierung an die Weltspitze Arbeit bedeutet. Dass viele der alten Strukturen (und Selbstverständlichkeiten) bei einer Neuaufstellung eben nicht mehr funktionieren.
Der nötige Wandel ist keine Hau-Ruck-Aktion, die man bestellen kann, sondern ein Weg, den das Orchester gemeinsam gehen muss. Und bergauf geht es sich nun einmal beschwerlich.
Vielleicht wollen die Wiener Philharmoniker aber auch einfach nur weitermachen wie bisher, sich noch ein bisschen Orden anspinnen lassen und Professorentitel verliehen bekommen. Das Magazin News wird dem Orchester dabei sicherlich auf die Schulter klopfen, und auch im österreichischen Magazin Profil ist alles Walzer. Hier schreibt Manuel Brug: »Kein Orchester weltweit spielt mehr, verdient besser, agiert flexibler.« Na dann: »Prosit Neujahr!«