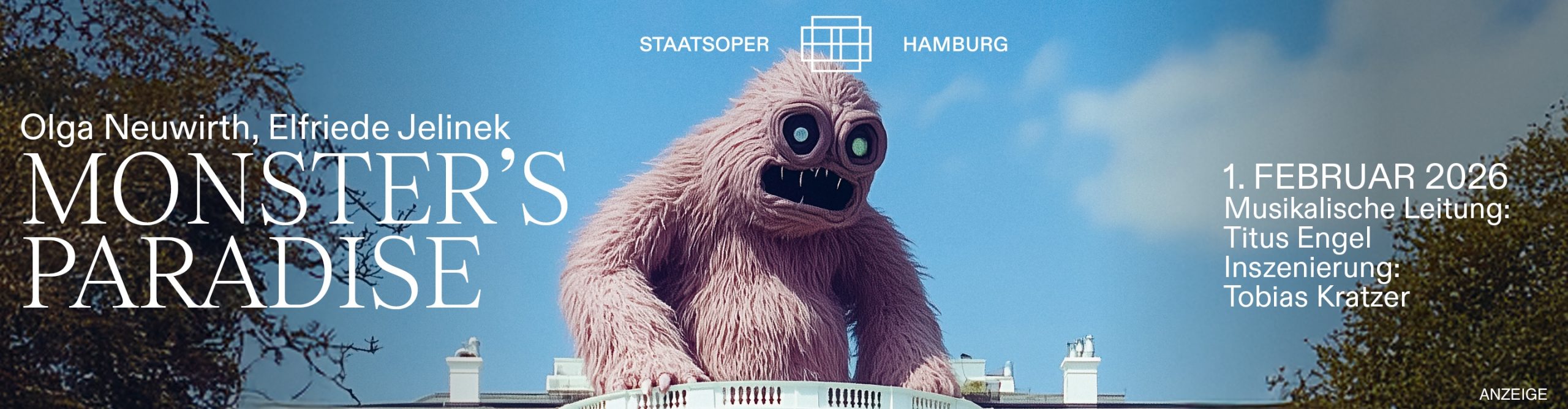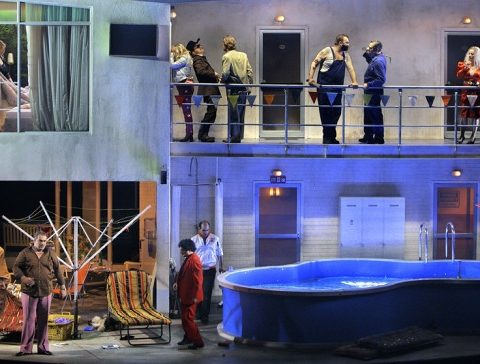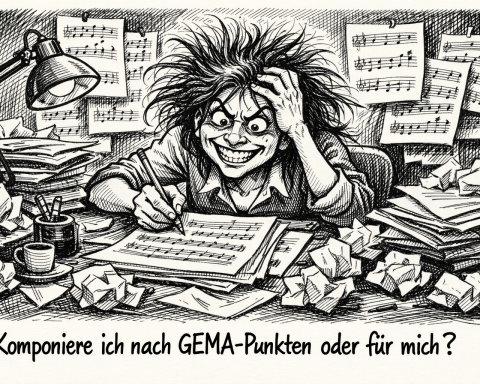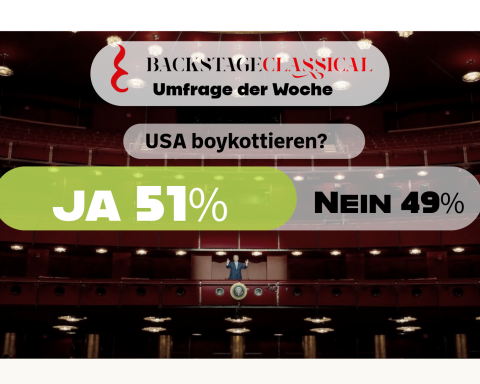Kommunen, Städte und Bund beschließen massive Sparpakete – besonders betroffen: Die Kultur. In Berlin, Dresden, München oder Leipzig kreist der Rotstift ebenso wie in Wien, Baden und Bregenz. Es ist absehbar, dass unsere Kulturlandschaft in den kommenden Jahren massiv neu geordnet wird.
English summary: Cities and governments in Germany and Austria are enacting major budget cuts, with culture hit hardest. Orchestras, theaters, and festivals face funding losses as municipalities struggle with record deficits. Cultural institutions must brace for structural change and justify public support amid growing financial pressure and shifting priorities.
In den Städten und Kommunen werden derzeit Einsparungen beschlossen, die in den kommenden Monaten den Druck auf die Kultureinrichtungen in Deutschland und Österreich erhöhen werden. Es ist absehbar, dass unsere Kulturlandschaft vor einem massiven Wandel steht. Große Einsparungen sind derzeit überall zu beobachten, in den städtischen Etats von Berlin bis München, aber auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der gerade die Überprüfung der Rundfunkorchester in Auftrag gegeben hat. Wer sich derzeit in Sicherheit wiegt, könnte morgen kaum noch Zeit haben, aus eigenen Stücken zu handeln. Denn eines zeichnet sich schon jetzt ab: Die klassische Musikkultur belastet mit ihren großen Personalausgaben (etwa für Orchester) die Haushalte besonders – und hier wird wohl oder übel eine Schrumpfkur beginnen. Die Verabschiedung von Sparhaushalten allerorten ist ein sicheres Zeichen, dass der große Strukturwandel nur noch eine Frage der Zeit ist.
»Es ist gar keine Kohle mehr da«
Im Zentrum stehen die deutschen Kommunen. Gerade hat der Städtetag einen Rundbrief verschickt, in dem er auf die rasant steigenden Ausgaben – vor allem im Sozialbereich und für Personal – aufmerksam macht, während die Einnahmen nicht ausreichend mitwachsen. 2024 verzeichneten die kommunalen Kernhaushalte mit knapp 25 Milliarden Euro das größte Defizit in der Geschichte der Bundesrepublik, und das Minus wird nach Einschätzung der Spitzenverbände in den kommenden Jahren auf jährlich über 35 Milliarden Euro steigen. »Defizite in nie gekannter Höhe türmen sich auf, absehbar steigende Kassenkredite läuten eine Zins-Schulden-Spirale ein und die Investitionen schrumpfen zusammen«, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände. Die Kommunen leisten schon jetzt deutlich mehr als ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen. Und besonders im Fokus stehen die Kultureinrichtungen.
Da es sich bei Theatern, Orchestern oder freien Ensembles um »freiwillige Ausgaben« handelt (im Gegensatz zu »Pflichtausgaben« wie Sozialbeiträgen oder Bildung), wird der Rotstift in der Kultur besonders schnell angesetzt.
Helmut Dedy, ehemaliger Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, wies bereits darauf hin, dass Kommunen »nicht schauen, ob sie sparen wollen, sondern wo sie sparen müssen«. Kulturfinanzierung falle dabei häufig als erstes den Rotstiftmaßnahmen zum Opfer, obwohl sie »wichtig für den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft« sei.
Gegenüber BackstageClassical erklärt der Kulturreferent von Ingolstadt, der ehemalige Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne: »Die Einbrüche bei den kommunalen Einnahmen sind drastisch«. Ingolstadt sei besonders betroffen, da die Stadt stark von der Gewerbesteuer des Volkswagen-Konzerns abhängig sei. Anstatt über kulturelle Teilhabe und Bildungsprojekte zu sprechen, gehe es inzwischen um die pure Existenz des kulturellen Lebens. »Wir müssen jetzt Kredite aufnehmen und schätzen, dass wir in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils 25 Millionen Euro einsparen müssen«, erklärt der Kulturreferent. Auch hier seien vor allem die freiwilligen Ausgaben, zu denen Kultur und Sport gehören, betroffen. Grandmontagne betont, dass es inzwischen ums nackte Überleben gehe: »Es ist gar keine Kohle mehr da, um zu agieren.« Es brauche eine neue Debatte darüber, wie die Finanzierung der Kultur gesichert werden kann, »sonst schaufeln wir uns am Ende unser eigenes Grab«, sagt der Kulturreferent.
Berlin ist nur die Spitze des Spar-Eisberges
An vielen Orten sind die Einsparungen inzwischen unübersehbar. Spitzenreiter ist die Bundeshauptstadt Berlin. Sarah Wedl-Wilson hat den undankbaren Job der Kultursenatorin von Joe Chialo übernommen. Sie moderiert den Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern klüger, aber irgendwann wird auch sie mit konkreten Maßnahmen an die Öffentlichkeit treten müssen. Ob sanfte Fusionen – etwa von Werkstätten – reichen, um am Ende die Sparziele zu erreichen, ist eher unwahrscheinlich.
Der Berliner Kulturetat sieht für 2025 bereits drastische Einsparungen von rund 130 Millionen Euro und damit etwa zwölf Prozent des ursprünglich angedachten Budgets vor. Und für die Jahre 2026 und 2027 plant der Berliner Senat weitere Kürzungen, jeweils etwa 110 Millionen Euro im Doppelhaushalt. Noch betont Kultursenatorin Wedl-Wilson, dass es keine Schließungen von Theatern geben soll und Sanierungen beispielsweise an der Komischen Oper fortgesetzt werden. Wie lange sie diesen Kurs noch fahren kann, ist fraglich.

Die Stadt Köln hat Einsparungen im Kulturbudget um rund 6 Millionen Euro geplant, was etwa 20 Prozent ausmacht, im Musikbereich drohen sogar Einsparungen von 27 Prozent. In Dresden wurde mit dem Haushalt 2025/26 beschlossen, der Kultur jährlich 2,5 Millionen Euro weniger zur Verfügung zu stellen. Die Kürzungen treffen insbesondere Theater, freie Projekte sowie weitere Kreativorte. Auch München muss gravierende Einschnitte im Kulturbudget hinnehmen. Im städtischen Haushalt machen die Sparmaßnahmen im Kulturbereich für 2025 rund 8,5 Prozent der gesamten Kürzungen aus – betroffen sind zentrale Institutionen wie die Münchner Philharmoniker, aber auch zahlreiche kleine Ensembles und Projekte. Der Kulturreferent der Stadt mahnte: »Wir erleben einen tiefen Einschnitt, der nicht spurlos an der kulturellen Infrastruktur vorübergeht.« In Leipzig erklärte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke gerade, dass die Einsparungen »wehtuen«. Betroffen sind nach ersten Planungen wohl die Oper, das Schauspiel und das Gewandhaus – ihre Zuweisungen sollen 2026 erneut um 914.200 Euro verringert werden.
Auch Österreich muss umdenken
Und selbst im Kulturland Österreich wird der Rotstift an der Kultur angesetzt. Die Subventionen für die Bregenzer Festspiele werden 2025 und 2026 von bisher 6,9 Millionen Euro um 30 Prozent auf rund 4,8 Millionen Euro jährlich gekürzt. Die begonnene Kooperation mit dem Burgtheater und etwa technische Neuerungen wie eine neue Überkopfbeschallung müssen verschoben werden. Das österreichische Kulturministerium plant für die kommenden Jahre bis 2028 ebenfalls massive Kürzungen: Der Kulturbereich soll von 670 Millionen Euro (2025) auf 522 Millionen Euro (2028) schrumpfen – das bedeutet einen Rückgang um rund 150 Millionen Euro innerhalb von drei Jahren.
Das Land Niederösterreich gab gerade bekannt, dass es am Orchester der Bühne Baden sparen wird. Das Orchester wird aufgelöst, ab der Saison 2027/28 wir das Tonkünstler-Orchester die Bespielung der Bühne Baden übernehmen. Der Fokus soll dann auf Operette und Musical liegen – Oper wird es keine mehr geben. »Wir spüren auf allen Ebenen – Bund, Länder, Gemeinden – budgetäre Herausforderungen, die auf uns zukommen, auch auf den Kulturbetrieb. Wir wollen proaktiv einen ersten, spürbaren Schritt und ein Zeichen setzen, als Beitrag für die Aufgabenreform des Landes Niederösterreich«, erklärt Paul Gessl, der Geschäftsführer der NÖ Kulturbetriebs GmbH, die Träger beider Orchester ist.
Und auch Salzburg ist von Kultur-Kürzungen betroffen: Die Salzburger Festspiele müssen in Zukunft aufgrund der angespannten Haushaltslage sparen, was zu Verzögerungen bei wichtigen Bau- und Investitionsprojekten, wie dem Umbau des Festspielbezirks, führen kann. Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler betont zwar die Bedeutung von Kultur als zentrale Lebensgrundlage, weist aber darauf hin, dass die Bundesregierung große Summen einsparen muss (6,4 Milliarden Euro im ersten und 8,7 Milliarden Euro im zweiten Jahr), weshalb die konkrete Umsetzung von Bauvorhaben ungewiss ist und Investitionen möglicherweise verschoben werden.

Viele der beschlossenen Einsparungen werden erst in den nächsten Monaten zu konkreten Reaktionen in den Häusern und Ensembles führen. Und es sieht nicht so aus, als würde sich die finanzielle Situation der öffentlichen Hand schnell verbessern. Kulturschaffende werden sich in Zukunft noch mehr als zuvor für ihre staatliche Unterstützung legitimieren müssen. Und Fragen, ob wir uns zu viel Kultur leisten, die gar nicht mehr nachgefragt wird, ob die Häuser sorgfältig genug mit ihren Geldern umgehen, ob es richtig ist ein System zu unterstützen, in dem üppige Gagen auf prekäre Arbeitsverhältnisse stoßen, werden unausweichlich auf den Tisch kommen. Theater, Orchester und freie Gruppen wären gut beraten, bereits jetzt passende Antworten parat zu haben.