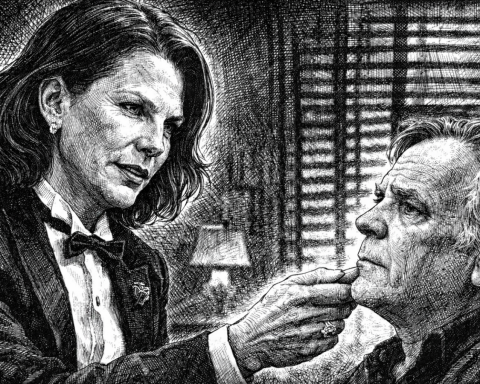Debatte: Die Pianistin Shoko Kuroe fordert in einer Replik auf den Essay von Susanne Rode-Breymann eine Versachlichung des Diskurses – die Musikhochschulen dürfen sich nicht aus der Verantwortung nehmen.
English summary: Pianist Shoko Kuroe calls for a more objective debate on abuse in classical music, responding to an essay by Susanne Rode-Breymann. She stresses that music academies must not evade responsibility, and that systemic issues—not just individual cases—must be addressed. Narratives must be carefully balanced to avoid stigmatizing victims or obscuring accountability.
Zunächst einmal ist jeder Beitrag, der sich zum Ziel setzt, Missbrauch und Gewalt in der Klassik entgegenzutreten, zu begrüßen. Backstage Classical hat kürzlich einen Aufsatz von Prof. Rode-Breymann aus dem neu erschienenen Jahrbuch Musik und Gender »Genie – Gewalt – Geschlecht« vorabgedruckt. Die Autorin hat unter anderem als Präsidentin der Musikhochschule Hannover (2010–2024) und als Initiatorin der Schriftenreihe Jahrbuch Musik und Gender für viel Fortschritt in ihrem Wirkungsbereich gesorgt. Der Aufsatz ist aus dieser Perspektive geschrieben. Die in dem Text enthaltenen Narrative regen allerdings auch zu weiteren Diskursen an.
Systemische Zuschreibung über »die« Musikhochschulen?
Susanne Rode-Breymannschreibt unter anderem über einen Spiegel-Bericht, den sie so einordnet:
»Zunächst zur systemischen Zuschreibung, die insbesondere der Spiegel zu seiner Stoßrichtung entwickelte, der viele folgten. Unter dem Titel Gefährliche Nähe legt der Spiegel im April 2019 den Finger in das, was er für die systemische Wunde dieses Hochschultyps hält und schreibt: ‚Künstlerische Hochschulen scheinen anfällig für Übergriffe sexueller Art zu sein. Das liegt in der Natur des Unterrichts, bei dem oft ein Lehrer und ein Schüler unter sich sind.‘ Das Narrativ, Einzelunterricht habe sexualisierten Machtmissbrauch gleichsam im Gefolge, diskreditiert die große Mehrheit von Lehrenden.«
Mich wundert, dass der Spiegel-Artikel von 2019 in dieser Hinsicht als »Stoßrichtungsgeber« empfunden wird. Erstens wurde dieses Narrativ vom Spiegel so nicht vertreten. Es sind lediglich zwei Sätze in einem zweieinhalbseitigen Artikel der Printausgabe. Die Autorin hatte im Vorfeld zahlreiche Fallrecherchen samt Verifizierung betrieben sowie Hintergrundgespräche mit Fachexpertinnen geführt. Das Narrativ existierte also bereits vorher, beispielweise in der 2006 von Prof. Freia Hoffmann herausgegebenen Publikation Panische Gefühle – Sexuelle Übergriffe im Instrumentalunterricht.
Nicht der Einzelunterricht vergewaltigt, sondern der Täter
Außerdem ist anzumerken, dass es Einzelunterricht nicht nur an Hochschulen gibt, sondern auch an Musikschulen oder im Privatunterricht. Studierende einer Musikhochschule sind oft selbst bereits Lehrende für Kinder oder Anfänger und geben Heim- oder Mobilunterricht. Nicht der Einzelunterricht vergewaltigt, sondern die Täterpersonen.
Gleichzeitig ist der Einzelunterricht ein branchenspezifischer Aspekt, mit dem professionell umgegangen werden muss. Zum einen geht es um die emotionale Bindung sowie die karrieretechnische Abhängigkeit, die während des langjährigen, engen Unterrichtsverhältnisses entstehen können, und die daraus resultierende gedankliche Manipulierbarkeit des Opfers.
Zum anderen geht es um die Möglichkeit, dass der Täter seine Missbrauchsabsicht als Unterricht tarnen kann, was dem Opfer eine rechtzeitige Abgrenzung erschwert. Einzelunterricht ist dabei natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten zur Tarnung – es kann sich auch zum Beispiel eine Kammermusikprobe oder eine Besprechung im Dirigentenzimmer handeln. In bestimmten Situationen, wie etwa bei der Szenenarbeit im Theater, kann die Tarnung sogar auch vor vielen Zuschauern funktionieren.
Es geht auch nicht darum, ob das Musikstudium gefährlicher ist als ein Biologiestudium oder ob ein Musikerberuf für Missbrauch anfälliger ist als ein Ingenieurberuf. Andere Berufe haben andere Tarnmöglichkeiten, z. B. körperliche Untersuchung in der Medizin oder Hilfestellungen beim Turnen. Man würde jedoch auch dort nicht fordern, gynäkologische Untersuchungen auf dem Krankenhausflur durchzuführen oder Mädchen ohne Sicherer turnen zu lassen. Die Dynamik des sexuellen Machtmissbrauchs ist überall gleich – nur die Details sind branchenabhängig unterschiedlich.
Die Macht der Lehrenden
Im Übrigen gehört die Macht der Lehrenden auch systemisch zum Musikstudium – durch ihre fachliche Expertise, durch die Notengebung und die Fördermöglichkeiten an der Hochschule sowie ihre Gatekeeper-Funktion in die Berufswelt. Auch hier sollte es darum gehen, die Macht nicht per se zu verteufeln, sondern damit verantwortungsbewusst und konstruktiv umzugehen.
Eine besonders heikle Situation im Musikstudium und Musikbetrieb entsteht, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen, zum Beispiel Täter und Macht und eine Eins-zu-Eins-Situation. In dieser Konstellation wird meist geschaut, welcher Faktor am leichtesten beseitigt werden kann.
Weiter schreibt die Autorin in ihrem Essay:
»Als 2015 ein Anfangsverdacht Ermittlungen gegen Siegfried Mauser auslöste, setzten die Überlegungen im Vorstand der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen in der HRK (= RKM) in eben jenem Spannungsfeld zwischen Individuum und System an, ausgehend von der Frage, ob wir es mit einem individuellen Fall zu tun hatten oder ob uns der Fall als RKM insgesamt etwas anging?«
Beim Thema sexueller Missbrauch sind einseitige Narrative schwierig, vor allem, insbesondere wenn sie eingesetzt werden, um die eigene Agenda zu untermauern. Selbst gut gemeinte Narrative haben immer auch Kehrseiten mit unerwünschten Nebenwirkungen.
Ein Täter kommt selten allein
Strukturdebatten sind essenziell. Richtlinien und Verhaltenskodex beispielweise waren unbedingt notwendig, um die Schutzlücken im Antidiskriminierungsgesetz auf eine andere Weise zu schließen. Denn ohne eine Rechtsgrundlage hat eine Institution im Ernstfall keine Handhabe gegen die Täter. Es ist auch wichtig, Missbrauchsfälle in Institutionen systemisch zu betrachten. Ein Täter kommt selten allein, und Sexualtäter sind oft Wiederholungstäter. Die Macht der Täter wird dadurch gestärkt, dass das Umfeld wegsieht und die Täter gewähren lässt.
Das Narrativ des »bedauerlichen Einzelfalls« wurde in der Vergangenheit zu oft benutzt, um den Missbrauch als eine private Angelegenheit zwischen zwei Einzelpersonen zu deuten. Der Täter ist jedoch ein Individuum. In einem konkreten Ernstfall hilft es niemandem, wenn die Institution als Reaktion eine zusätzliche Richtlinie erlässt, anstatt gegen den Täter vorzugehen. Narrative wie »Bei uns müssen alle einen Vertrag unterschreiben, dass sie nicht übergriffig werden, deshalb kann es bei uns keine Übergriffe geben« sind reine Beschwichtigungen.
Ein weiteres Beispiel ist das Narrativ bei der Aufklärung. Wo sexuelle Übergriffe in der Kultur teilweise noch als Kavaliersdelikte abgetan werden, ist die Formulierung der Rektorenkonferenz notwendig: »Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt sind Verletzungen des Persönlichkeitsrechts. Die Folgen sind schwerwiegend, persönlich sehr belastend und beeinträchtigen die berufliche Entwicklung.« Die eigentliche Intention dieses Narrativs ist, dass allen klarzumachen, dass es sich bei den Übergriffen um ernsthafte Taten handelt, die verhindert werden müssen.
Zwischen Berichterstattung und Strukturdebatte
Die Kehrseite des Narrativs ist jedoch, dass Betroffene, wenn sie sich als betroffen outen, als schwach stigmatisiert und klein gehalten werden können. Das kann eine zusätzliche Hürde für ihre zukünftige Karriere bedeuten. Es kann auch dazu führen, dass die Betroffenen aus Angst vor einer Stigmatisierung erst recht nicht reden.Auch wenn sich das Dilemma sich nicht vollständig lösen lässt, wäre es gut, sich dessen zumindest bewusst zu werden.
In der öffentlichen Debatte ist es eine Gratwanderung, eine gute Balance zwischen dem Fokus auf konkrete Fälle – meist in der Form einer Verdachtsberichterstattung über Prominente – und dem Fokus auf grundlegende philosophische, historische, soziale und strukturelle Überlegungen zu finden.
Nur sehr wenige Fälle finden den Weg in die Medien, zumal das Presserecht in Deutschland die Persönlichkeitsrechte der Verdächtigten richtigerweise streng schützt und Journalisten sich und ihre Quellen vor SLAPP-Klagen schützen müssen. Die Strukturdebatte lässt sich aber öffentlich auch nur anhand der veröffentlichten Fälle und wissenschaftlicher Studien wie der Münchner Studie zu Machtmissbrauch, Diskriminierung und sexualisierter Gewalt führen.
Das Spannungsfeld zwischen öffentlichem Druck und interner Aufarbeitung beschreibt die Musikjournalistin Anne Midgette in ihrem offenen Brief an die Klassikszene eindrücklich. Auch die Investigativjournalistin Edith Meinhart thematisiert in ihrem Dunkelkammer-Podcast Nr. 187 die Schnittstelle zwischen Investigativ- und Kulturjournalismus, zwischen der Aufdeckung von Missständen und deren Sublimation in die gesellschaftliche Relevanz.
Versachlichung der Diskurse
Es ist Zeit für sachliche Diskurse innerhalb der Musikszene Solange sexuelle Gewalt noch ein Tabuthema in der Gesellschaft und in der Kultur war und die vorherrschenden Narrative verleugnend, beschönigend oder bagatellisierend waren, wurde innerhalb der organisierten Gegenbewegung – beispielsweise in der Gleichstellung – oft eine einheitliche Haltung als Form des Zusammenhalts erwartet, um nach außen hin keine Blöße zu geben.
Seit MeToo ändert sich die Situation allmählich. Mittlerweile ist es gesellschaftlicher Konsens, dass Missbrauch und Gewalt nicht akzeptabel sind. Es sind differenzierte Zwischentöne und neue Perspektiven in der Debatte möglich. Stimmen, die bisher nicht zählten, können Gehör finden. Es wäre schön, wenn die Chance genutzt wird.
Transparenzhinweis: Ein Aufsatz von Shoko Kuroe befindet sich ebenfalls in dem Band Genie –Gewalt – Geschlecht. Sie war auch in die Spiegel-Recherche zum Artikel „Nähe und Distanz“ involviert