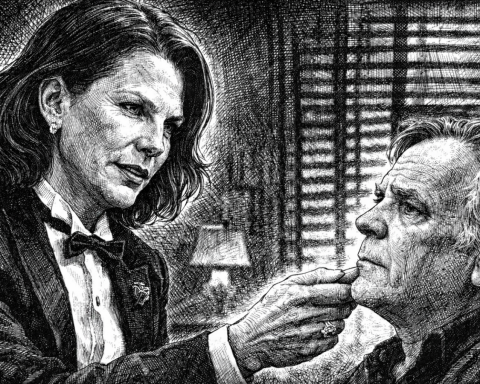Die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv ist seit Jahren stabil in Ihrer Haltung zum Angriffskrieg Russlands und im Umgang mit russischer Musik. Hier erklärt sie, warum die Absage des Gergiew-Auftritts richtig war und wie es Musikerinnen und Musikern in ihrer Heimat ergeht.
English summary: Ukrainian conductor Oksana Lyniv remains firm in her stance against Russia’s war and its cultural propaganda. Lyniv emphasizes the role of music in giving Ukrainians hope amid war. She supports cultural resilience through young Ukrainian talent, exile initiatives like the Kyiv Symphony Orchestra, and criticizes the misuse of art for political purposes. Lyniv advocates for a conscious approach to Russian repertoire and highlights the importance of Ukrainian cultural visibility worldwide
BackstageClassical: Im vierten Jahr des Krieges sind die russischen Angriffe auf die Ukraine so heftig wie nie zuvor. Angesichts dieses Terrors – welche Rolle spielt die Musik?
Oksana Lyniv: Erstaunlicherweise merkt man in schwierigen Zeiten das besondere Bedürfnis nach Kunst: In der Ukraine ist die Nachfrage nach kulturellen Veranstaltungen so groß wie nie zuvor. Wenn man zu einem Konzert geht, bedeutet das: man lebt noch. Es ist ein Stück Normalität, ein Moment aus der Vergangenheit vor dem Krieg – und eine Hoffnung auf die Zeit nach dem Krieg. Die Menschen halten sich daran fest, um das Leben zu feiern, und nicht in Depression und Pessimismus zu versinken.
Für Ende Juli ist ein Auftritt Valery Gergievs im Königspalast von Caserta geplant gewesen – er wurde erst in letzter Minute und nach großen Protesten abgesagt. Wie geht es Ihnen damit – auch als Chefdirigentin des Theaters in Bologna?
Ich denke, dass solche Entscheidungen in Italien – wie in vielen Teilen Europas – stark von der politischen Stimmung in der jeweiligen Region abhängen. Bologna zum Beispiel ist eine Partnerstadt von Charkiw, es gibt einen lebendigen Dialog, viele gemeinsame Projekte – wie Studierendenaustausch und sogar Rehabilitationsprogramme für Kinder aus frontnahen Gebieten. Ein anderes Beispiel ist Mailand: 2022 lud man dort Gergiev von der Scala aus. Nicht auf Wunsch des Theaters selbst, sondern aufgrund des Engagements von Bürgermeister Giuseppe Sala. Er sagte sehr klar, dass jemand, der so eng mit dem russischen Regime verbunden sei, keinen Platz in einer Stadt haben dürfe, die demokratische und humanistische Werte verteidigt. Auch deshalb bedauere ich, dass die Region Salerno unter dem Deckmantel der Kunst einen Menschen einladen wollte, der direkt mit einem Verbrecher-Regime verbunden ist – und von diesem finanziert wird. Das Konzert wäre ein Missbrauch der Kultur und ein erschreckendes Beispiel politischer Propaganda gewesen.
Wie ist die Situation der Künstlerinnen und Künstler in der Ukraine?
In der Ukraine lebende Künstlerinnen und Künstler sind glücklich, wenn ihre Stimmen international gehört werden. Und ich freue mich, wenn ich als Dirigentin, die schon länger international auftritt, etwas für sie tun kann – besonders für die junge Generation. Oft entstehen auch neue Werke, die auf ihre Weise die aktuellen Ereignisse reflektieren. So habe ich kürzlich mit der jungen Komponistin Mariia Khodakivska aus Lwiw zusammengearbeitet, die in der Klasse des renommierten ukrainischen Komponisten Yurii Laniuk studiert. Mariia ist erst 21 Jahre alt, aber der Musikverein Graz hat sie bereits mit einem Werk beauftragt. Ihr Stück Die Jahreszeiten für Flöte, Violoncello und Orchester, habe ich mit dem Grazer Jugendorchester Alpe Adria uraufgeführt. Jetzt wird es auch im Rahmen meiner kommenden Tournee mit dem Jugendsinfonieorchester der Ukraine in Deutschland in der Kronberg Akademie, bei Blenio Musikfestival in der Schweiz und in Bratislava erklingen. Das ist ein sehr wichtiger Impuls für die Zukunft.
Von Anfang an spielte die Aggression auch auf der kulturellen Ebene. Wie können sich ukrainische Kulturschaffende gegen den russischen Imperialismus wehren?
Ich sehe den richtigen Weg in der Entwicklung der eigenen Kultur, Wissenschaft und Identität. Jahrhunderte der Herrschaft haben die Russen Möglichkeiten gehabt, uns als Nation unsichtbar zu machen. Wir müssen aber jetzt nach vorne schauen und unsere Zukunft aufbauen. Die europäische Integration und die Unterstützung der jüngeren Generationen sind dafür enorm wichtig.
Wie stehen Sie zu den Vorgaben des ukrainischen Kulturministeriums, das nach wie vor empfiehlt, russische Komponisten zu boykottieren?
Die ukrainische Verfassung garantiert die Freiheit der Kunst. Doch seit Beginn der Vollinvasion hat das Kulturministerium eine Empfehlung ausgesprochen, Werke russischer Komponisten vorerst nicht mehr aufzuführen. Die meisten ukrainischen Kulturinstitutionen halten sich daran. Für einzelne Künstlerinnen und Künstler, die im Ausland tätig sind, ist die Situation jedoch eine andere. Ich war von 2021 bis 2024 Chefdirigentin des italienischen Orchesters Teatro Comunale di Bologna – dort, wie auch in den anderen italienischen Musikinstitutionen, gehören Werke russischer Komponisten, die in der Vergangenheit entstanden sind, fest zum klassischen Repertoire.
Wie gehen Sie persönlich mit dieser Frage um?
Mir ist es sehr wichtig, zwischen dem künstlerischen Wert eines Werkes und dem Missbrauch von Kunst zu unterscheiden, aber dafür braucht es eine bewusste Auseinandersetzung. Das habe ich immer wieder versucht zu vermitteln. Es ist unmöglich, dieselben Maßstäbe, die für ukrainische Künstler im Inland gelten auch im Ausland anzusetzen. Dafür wurde ich in der Ukraine kritisiert. Trotzdem verstehe ich, dass die Menschen, die vom Krieg unmittelbar betroffen sind, eine emotionale Abneigung empfinden und eine andere Meinung haben können. Gleichzeitig halte ich es für sehr wichtig, dass ukrainische Künstlerinnen und Künstler heute international präsent sind – an führenden Theatern, in bedeutenden Konzertsälen, auf großen Festivals. Das ist entscheidend für die Sichtbarkeit unserer Kultur. Ich setze mich also für eine differenzierte Auseinandersetzung ein – und versuche mich dabei nicht auf Kritik zu fokussieren, sondern darauf, was ich effektiv tun kann, um die Ukraine kulturell und künstlerisch zu stärken.

Seit Februar 2022 sind viele ukrainische Kulturschaffende nach Europa, sehr viele nach Deutschland geflüchtet. Gibt es Initiativen, ukrainische Kultur aus dem Exil heraus zu organisieren?
Ja, viele! Ich bin Gast-Chefdirigentin des ukrainischen Orchesters Kyiv Symphony Orchestra, das derzeit in Monheim am Rhein in einer Art Residenz als Exil-Kulturbotschafterin tätig ist. Denn das Orchester führt in fast jedem Programm Werke ukrainischer Komponisten auf und entdeckt so eine ganze Schicht des unbekannten Repertoires für das europäische Publikum neu. Eine weitere Initiative, die ich eng begleite, ist der International Odesa Violin Competition, der jetzt im August zum ersten Mal im Exil, in Monheim am Rhein stattfinden wird. Mein Mann, der aus Odesa stammende Geiger Andrii Murza hat ihn 2018 in Odesa ins Leben gerufen. Er ist der berühmten Odesaer Geigenschule gewidmet – einer der bedeutendsten weltweit. Absolventen dieser Schule sind weltweit bekannte Namen: David Oistrach, Nathan Milstein, Boris Goldstein, Zakhar Bron. Nur wenige können sich vorstellen, unter welchen Bedingungen diese herausragende Schule – die nach P. Stoljarskyj benannt ist – heute in Odesa weiter arbeitet: unter Beschuss und ständiger Lebensgefahr. Am 24 August 2025 werde ich das Finale des Wettbewerbs mit dem Kyiv Symphony Orchestra dirigieren.
Existiert innerhalb der klassischen Musikszene inzwischen eine Organisation, die die unterschiedlichen Exil-Projekte zusammenführt?
Eine zentral organisierte Szene gibt es eher nicht – vielmehr haben sich zahlreiche individuelle Initiativen ukrainischer Künstlerinnen und Künstler entwickelt. Über viele Jahrzehnte hinweg war ukrainische Kunst in Europa kaum sichtbar oder wurde im Schatten russischer Kultur wahrgenommen. Aufgrund historischer Umstände galten ukrainische Künstler lange Zeit ausschließlich als Vertreter der russischen Kulturszene. Die ukrainische Sprache war über Jahrhunderte hinweg unterdrückt, teilweise sogar verboten. Unter der Herrschaft der Zaren war es nicht erlaubt, auf Ukrainisch zu unterrichten, zu publizieren oder Theater zu spielen – stattdessen dominierte die russische Sprache.
Dabei ist die Geschichte voll von ukrainischen Künstlern mit Weltklasse…
Ein prägnantes Beispiel ist der Komponist Dmytro Bortnjanskyj, ein Zeitgenosse Mozarts, der im Dorf Hluchiw (heute Oblast Sumy) geboren wurde. Als hochbegabter Schüler der Hluchiwer Sängerschule wurde er früh an die kaiserliche Kapelle nach Sankt Petersburg geholt. Nach einem Studium in Italien kehrte er in die russische Hauptstadt zurück und gilt heute als Begründer der russischen Chorkunst – obwohl er musikalisch stark von der ukrainischen mehrstimmigen Gesangstradition geprägt war, wie auch viele Mitglieder der Petersburger Hofkapelle, die zuvor in Hluchiw ausgebildet wurden.
Wo waren Sie selbst als der Angriff am 24.02.2022 startete?
Ich war gerade auf dem Rückweg von Wien, wo ich mit dem RSO Wien das Requiem von Dvořák dirigiert hatte – inhaltlich und emotional ein sehr symbolträchtiges Konzert. Auf dem Weg zu meinen nächsten Proben in Bologna erhielt ich in den frühen Morgenstunden die ersten schrecklichen Nachrichten vom Angriff. Bereits am Tag nach dem Überfall versammelten sich auf der Piazza Maggiore in Bologna über zehntausend Menschen. Es sprachen der Bürgermeister Matteo Lepore, viele andere Politiker, auch ich. Diese große Solidarität war für mich sehr bewegend und zugleich ein wichtiges internationales Zeichen. – Ein sehr deutliches, dass Italien für Europa und eine freie Ukraine steht.
Wie erleben Sie die Solidarität Ihrer westlichen Kolleginnen und Kollegen?
Ich empfinde große Unterstützung – vor allem bei meinen internationalen Projekten und Kooperationen. Während meiner dreijährigen Tätigkeit als Chefdirigentin am Teatro Comunale di Bologna gab es zahlreiche Initiativen mit Bezug zur Ukraine. Überall in Europa und Asien sind bedeutende und bewegende Projekte entstanden – und es gibt weitere Pläne für die Zukunft. Besonders schätze ich die vielen privaten Engagements westlicher Musikerinnen und Musiker. Kürzlich erfuhr ich beispielsweise von einer wunderbaren Aktion der Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Federico Kasik, dem stellvertretenden 1. Konzertmeister. Er hat früher an der Musikakademie in Lwiw studiert und lud 2023 seine Kolleg:innen ein, an Konzerten und Meisterklassen in Lwiw mitzuwirken.